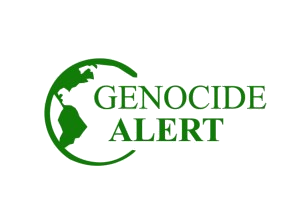Nach der Autorisierung eines Einsatzes von 6.000 afrikanischen und 1.600 französischen Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik durch die UN im Dezember, erwägt nun auch die EU, eigene Truppen zu entsenden. Sie könnte somit doch noch einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung schwerer Menschenrechtsverbrechen in der Zentralafrikanischen Republik leisten. Erforderlich sind dringend benötigte humanitäre Hilfsmaßnahmen wie auch weitere finanzielle und logistische Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union. Wie ein Blick auf die Hintergründe des Konfliktes zeigt, handelt es sich bei dessen jüngster Eskalation um eine Folge langjähriger Regierungsprobleme und chronischer Instabilität. Ungeachtet des Rücktritts von Präsident Djotodia aufgrund des Drucks seitens der Nachbarstaaten, wird ein längeres Engagement der internationalen Gemeinschaft erforderlich sein, um zukünftige Gräueltaten zu verhindern.
Seit der ehemalige Präsident François Bozizé am 15. März 2013 durch die mehrheitlich muslimischen Séléka-Rebellen unter Michel Djotodia gestürzt wurde, befindet sich die Zentralafrikanische Republik in einer dramatischen Gewaltspirale. Angesichts des Zusammenbruchs staatlicher Institutionen, teils anarchischer Zustände und zahlreicher Menschenrechtsverbrechen diverser Milizen steht das knapp 4,6 Millionen Einwohner zählende Land vor einer humanitären Katastrophe. Die Gewalt forderte bereits mehrere hunderte Tote. Fast zwanzig Jahre nach dem Völkermord in Ruanda bestand in Folge zunehmend interreligiöser Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik die unmittelbare Gefahr, dass eine Krise anhaltender Gewalt zu einem Völkermord eskaliert. Allein im Dezember starben trotz internationaler Truppenpräsenz über 1.000 Zentralafrikaner.
Sicherheitsratsresolution 2127
Die UN-Sicherheitsratsresolution 2127 am 5. Dezember 2013 sowie vorherige Debatten innerhalb der UN zu Zentralafrika zeigen die Sensibilität der internationalen Gemeinschaft seit dem Genozid in Ruanda. Die Resolution autorisiert ein Eingreifen französischer und afrikanischer Truppen und demonstriert die Bereitschaft, in Reaktion auf schwere Menschenrechtsverbrechen und der Gefahr eines Völkermordes in Zentralafrika, der Schutzverantwortung nachzukommen. Ziel ist es, eine weitere Eskalation zu verhindern und Menschenleben zu retten. Die Resolution ist aber auch Ausdruck des Versagens der regionalen „Economic Community of Central African States“ (ECCAS) und der langen, chronischen Instabilität in der Mitte Afrikas. Sowohl die zentralafrikanische Regierung unter dem neuen Präsidenten und ehemaligen Séléka-Führer Michel Djotodia, als auch ECCAS und die Afrikanische Union haben am 25. November 2013 vor dem UN-Sicherheitsrat um Unterstützung gebeten. Zuvor hatte der französische Präsident Hollande trotz der Präsenz von 250 französischen Soldaten am Flughafen der Hauptstadt Bangui ein Eingreifen ohne UN-Mandat abgelehnt.
Die UN-Resolution beschließt die Aufstockung der schon länger im Land stationierten „Mission for the consolidation of peace in Central African Republic“ (MICOPAX) der ECCAS. Dafür wurde ein bereits beschlossener Übergang von MICOPAX in eine „International Support Mission in the Central African Republic“ (MISCA) der Afrikanischen Union sowie die Stationierung von 1.600, schnell in Kampfhandlungen verwickelte, französischen Soldaten autorisiert. Zusätzlich verhängte der UN-Sicherheitsrat ein Waffenembargo. Schon MICOPAX fehlte es zur akuten Verhinderung von Gräueltaten an Truppenstärke sowie an logistischer und finanzieller Unterstützung. Das gilt auch für MISCA, die über 2.500 Soldaten verfügte und deren Zahl soll auf bis zu 6.000 steigen soll. Ein Blick auf die Hintergründe des Konflikts zeigt, dass MISCA wie zuvor MICOPAX an einer langfristigen Befriedung der zentralafrikanischen Republik scheitern wird, wenn die Ursachen der chronischen Instabilität des Landes nicht angegangen werden.
Hintergrund des Konfliktes: Chronische Instabilität
Die Zentralafrikanische Republik ist nicht erst seit März 2013 oder Dezember 2012 ein Ort von Instabilität. Seit dem Ende der französischen Kolonialherrschaft 1960 sind dafür vor allem die zahlreichen Putsche kennzeichnend – teils unrühmlich mitgetragen durch die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Auch der im März 2013 durch die Séléka gestürzte François Bozizé erlangte das Präsidentenamt im März 2003 durch einen Staatsstreich.
Bozizé wurde seitdem zweimal durch Wahlen bestätigt. Effektive staatliche Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet erlangte er jedoch nie. Die Zentralafrikanische Republik wurde schon zuvor weitgehend von lokalen Rivalitäten um Diamanten und Gold sowie regionalen Konflikten dominiert. Wie die International Crisis Group bereits 2010 berichtete, sicherte sich Bozizé die Kontrolle über den Diamantensektor, um die eigene ethnische Gruppe zu bereichern, während die Bevölkerungsmehrheit unter großer Armut litt. Ein parasitärer Staat, Armut, Korruption und größtenteils nichtverfolgte Kriminalität erleichterten bewaffneten, kriminellen Gruppen und Rebellen das Anwerben neuer Rekruten zur Eroberung von Diamantengebieten erheblich. Derartige Einkommensquellen boten und bieten einen großen Anreiz für Rebellen und Kriminelle, sich nicht entwaffnen zu lassen.
Zur Destabilisierung trugen zudem Konflikte in den Nachbarstaaten bei. Der vom Tschad, Sudan, Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo, der Republik Kongo und Kamerun umschlossene Binnenstaat wurde vor allem im Norden und im Osten immer wieder als Rückzugsgebiet für Kämpfer in den innerstaatlichen Konflikten der Nachbarstaaten genutzt. Dazu zählt etwa der Darfurkonflikt, aber auch die Zeit vor der Staatengründung des Südsudans. Ethnische Spannungen verursacht zudem der Rückzug der Lord’s Resistance Army (LRA) um Joseph Kony in den Nord-Osten der Zentralafrikanischen Republik. Dass die Zentralafrikanische Republik selbst in drei Flüchtlingslagern etwa 12.000 Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten beherbergt, während nun 64.000 Zentralafrikaner wiederum als Flüchtlinge in den Nachbarstaaten registriert sind, verdeutlicht die wechselseitige Instabilität der gesamten Region.
Der Bürgerkrieg
Notorische Governance-Probleme, eine traurige Bilanz an Menschenrechtsverletzungen und eine Marginalisierung der muslimischen Minderheit in der Zentralafrikanischen Republik resultierten bereits in mehrere Rebellionen unter François Bozizé. Die Séléka, ein Zusammenschluss zweier Rebellengruppen aus dem Nordosten der Republik, warfen Präsident Bozizé im Dezember 2012 die Verletzung eines Friedensabkommens von 2007 vor. Die hauptsächlich muslimischen Rebellen, die sich auch aus Kämpfern aus dem Tschad und dem Sudan und zu etwa 10% aus Anhängern anderer Religionen zusammensetzen, eroberten große Teile des Landes, bevor sie im Januar 2013 unter Vermittlung der Regionalorganisation ECCAS einem Waffenstillstandsabkommen zustimmten.
Eine nationale Einheitsregierung aus Bozizé, Opposition und Rebellenführern sollte unter Aufsicht von Friedenstruppen der MICOPAX die Region stabilisieren und über eine Road-Map im Februar 2016 zu Neuwahlen führen. Laut einer Analyse der International Crisis Group scheiterte dieser Transitionsprozess letztlich am Widerstand Bozizés, die Macht tatsächlich zu teilen.
Die Einnahme des Präsidentenpalastes durch Séléka-Rebellen am 24. März 2013 markierte somit nicht nur die Niederlage Bozizés sondern auch der MICOPAX vor Ort. Die Mission scheiterte aufgrund mangelnder Truppenstärke, logistischer Unterstützung, politischem Willen sowie Meinungsverschiedenheiten mit Südafrika, das auf Einladung Bozizés ebenfalls mit Truppen im Land präsent war. Im Gegensatz zu MICOPAX wurden diese in ein Gefecht mit den Séléka verwickelt, in dessen Folge sie sich aus Zentralafrika zurückzogen. Aufgrund der logistischen Probleme sah sich MICOPAX auch nach dem Putsch nicht in der Lage, Gräueltaten effektiv Einhalt zu gebieten und eine staatliche Ordnung wiederherzustellen – obgleich manche Truppen lokal maßgeblich zur Sicherung von Zivilisten beitrugen. Der im Ausland befindliche Ex-Präsident droht seitdem mit der Rückeroberung des Landes.
Zusammenbruch staatlicher Institutionen
Der selbsternannte und mittlerweile, am 10. Januar 2014 zurückgetretene Präsident und ehemalige Séléka-Führer Michel Djotodia war unterdessen nicht in der Lage, der Gewalt Einhalt zu bieten. Seitdem Djotodia angesichts der anarchischen Zustände die Séléka im September 2013 formell für aufgelöst erklärte, kommt es davon unbeeindruckt weiterhin zu intensiven Auseinandersetzungen zwischen Ex-Séléka, Unterstützern des ins Ausland geflüchteten ehemaligen Präsidenten Bozizé, diversen „Selbstverteidigungsgruppen“ wie der christlichen Anti-Balaka („Anti-Machete“ in Sango) und der ethnischen Gruppe der Gbaya. Staatliche Institutionen sind unterdessen zusammengebrochen, zivile Mitarbeiter geflohen und grundlegende staatliche Aufgaben zum Stillstand gekommen. Vor diesem Hintergrund bezeichnete Thierry Vircoulon, Projekt-Direktor der International Crisis Group für Zentralafrika, die Entwicklung als „coup de trop – the final push“ für die seit langem von Konflikten und humanitären Notstand gezeichnete Zentralafrikanische Republik.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Wie Human Rights Watch in einem ausführlichen Bericht über „die vergessene Krise“ festhielt, wurden allein zwischen März und Juni über 1.000 Hütten verbrannt. Vor allem die Séléka, aber auch Anti-Balaka, andere Milizen und Regierungstruppen, verübten zahlreiche Menschenrechtsverbrechen. Im Laufe des Konflikts dokumentierten UN-Mitarbeiter und Menschenrechtsorganisationen landesweit zahlreiche Massaker, gezielte Tötungen, willkürliche Festnahmen, den Einsatz von Folter, Vergewaltigungen und Banditentum. Etwa ein Jahr nach Beginn der Rebellion im Dezember 2012 befinden sich nach Daten der UN-Stelle für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten OCHA derzeit über 935.00 Zentralafrikaner auf der Flucht. Allein 512.000 von ihnen befinden sich in der Hauptstadt Bangui, 100.000 auf dem von französischen Truppen gesicherten Flughafen. Vor Ort tätige UNICEF-Mitarbeiter schätzen die Zahl der Kindersoldaten innerhalb der Milizen auf etwa 6.000, deren Rekrutierung nach dem Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) ein Kriegsverbrechen darstellt.
Zusätzlich zu den Kampfhandlungen und Plünderungen steht das Land vor einer humanitären Katastrophe. Eine gemeinsame Studie der UN, diversen NGOs und der zentralafrikanischen Regierung zeigte bereits im März 2013, dass über eine Million der 4,6 Millionen Bürger Zentralafrikas vor der Gefahr einer Hungersnot stehen. Großen Teilen der verängstigten Bevölkerung bleibt nur die Wahl, entweder im Busch zu leben und dort zu hungern oder in urbane Gebiete zu fliehen, in denen sie oft weiteren Menschenrechtsverstößen ausgesetzt sind. Eine Situation, die sich angesichts der Plünderungen, schwacher Ernte und des Zusammenbruchs der Wirtschaft verschlimmern wird. Housainou Taal, Beauftragter des Welternährungsprogramms der UN für die Zentralafrikanische Republik, forderte im August 2013 unmittelbares humanitäres Engagement sowie die Respektierung von Zivilisten und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe. Zuvor waren u.a. Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und Caritas angegriffen worden. Die Verteilung dringend benötigter Nahrungsmittel sowie medizinische Hilfe gestaltet sich aufgrund der anhaltenden Gewalt und trotz der stationierten Soldaten selbst in der Hauptstadt und am Flughafen weiterhin als schwierig. Viele Teile des Landes sind unerreichbar. Gezielte Angriffe auf die internationalen Truppen haben zuletzt zugenommen und auch Gräueltaten gegenüber der Zivilbevölkerung sind nicht abgebrochen.
Handlungsoptionen
Angesichts der anarchischen Zustände ist es zunächst die Hauptaufgabe im Sinne der Schutzverantwortung die öffentliche Ordnung wieder herzustellen und den unmittelbaren Schutz von besonders gefährdeten Zivilisten in Bangui, Bossangoa und im Nordwesten des Landes zu gewährleisten. Dringend ist die vollständige Aufstockung der MISCA auf die geplanten 6.000. Hierfür stellen die USA Transportflugzeuge in Burundi und bisher 40 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die EU beteiligt sich mit 50 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Die UN-Mission im Südsudan mit etwa 7.600 Soldaten und 2.200 zivilen Mitarbeitern verfügt über ein Budget von 924 Millionen US-Dollar für 2013/14. Weitere logistische und finanzielle Unterstützung ist für einen Erfolg der schlecht ausgerüsteten MISCA in oft schwer zugänglichen Gebieten für einen unmittelbaren Erfolg essenziell.
Zur Stabilisierung ist die Errichtung sicherer Korridore für dringend benötigte humanitäre Hilfsmaßnahmen ein weiterer wichtiger Schritt. Wie Ärzte ohne Grenzen in einem offenen Brief am 12. Dezember 2013 deutlich machten, kommt es seitens der UN und ihrer Mitarbeiter vor Ort zu gravierenden Mängeln. Die humanitäre Hilfe seitens der UN vor Ort muss daher erheblich intensiviert werden. Der ausgearbeitete „Strategic Response Plan 2014“ ist unterdessen mit nur 11 der veranschlagten 247 Millionen US-Dollar massiv unterfinanziert. In Reaktion auf die jüngsten massiven Verschlechterungen der Situation und angesichts über 1,2 Millionen Hilfsbedürftiger, werden laut OCHA zudem 152,2 Millionen US-Dollar zur Soforthilfe benötigt.
Zur Verhinderung weiterer Gräueltaten zwischen Christen und Muslimen, die als Produkt und nicht als Grund der Rebellion anzusehen sind, sollte die UN Stabilisationsmaßnahmen, wie interreligiösen Dialog und dringend benötigte Wiederaufbauhilfe in betroffenen Gebieten einleiten. Zur Befriedung gehört auch ein Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Reintegrationsprogramm für Ex-Séléka, Anti-Balaka-Milizen und Anhängern Bozizés.
Bei aller Dringlichkeit zur sofortigen Hilfe muss klar sein, dass die Wiederherstellung der Ordnung im Staatsgebiet in jedem Fall eine langfristige Aufgabe darstellen wird. Hierfür ist angesichts der Landmasse bei Nicht-Kooperation der Milizen ein Ausbau der Truppenkontingente erforderlich. Die geplanten Soldaten werden bei anhaltender Gewalt landesweit nicht ausreichen. Die Afrikanische Union bei dieser Aufgabe zu unterstützen kommt dem Anspruch der AU nach, etwa wie in Somalia selbst zu einer Stabilisierung beizutragen. Wie in der Sicherheitsratsresolution 2127 festgehalten, sollte die Entwicklung im Land weiterhin genau beobachtet werden und eine mögliche Umwandlung der MISCA in eine UN-Mission im Auge behalten werden. Hierfür könnte laut Resolution Personal aus den UN-Missionen in den Nachbarstaaten bereit gehalten werden. Dieses scheint aktuell aber mit der Krise im Südsudan überlastet.
Truppen der Europäischen Union könnten bei diesen Aufgaben die französischen und Afrikanischen Soldaten entlasten. Die diskutierten 800 bis 1.200 Soldaten würden neben dem Schutz von Zivilisten auch durch Aufklärung, medizinische Unterstützung und Transporthubschrauber einen Beitrag zur Stabilisierung der Hauptstadt und zur Erleichterung der Arbeit von Hilfsorganisationen leisten können.
Das in der Resolution beschlossene Waffenembargo sollte aufrechterhalten werden, bis eine stabile politische Ordnung wieder hergestellt und eine politische Lösung gefunden ist. Zusätzlich zum Waffenembargo können gezielte Sanktionen gegen Personen verhängt werden, die sich an Gräueltaten beteiligen und Verhandlungen boykottieren. Wie jüngst in einem Policy Paper von Genocide Alert ausgearbeitet, können mit gezielten Sanktionen effektiv Gräueltaten verhindert werden, wenn sie als Teil einer Gesamtstrategie von anderen politischen Maßnahmen begleitet werden.
Die Zentralafrikanische Republik ist Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Verantwortliche für Menschenrechtsverbrechen und Gruppierungen, die Kindersoldaten einsetzen, sollten angeklagt werden. Die UN und die Übergangsregierung könnten hierfür ein Team zur Untersuchung begangener Straftaten ins Land entsenden und unterstützen. Ein Fokus der Truppen vor Ort sollte außerdem die Unterstützung und Absicherung des „UN Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic“ (BINUCA) sein, der vor dem Putsch bereits das Mandat hatte, die Einhaltung von Menschenrechten zu überwachen und bei der politischen Transition zu assistieren.
Letztlich zeigt der Blick auf den Hintergrund der Gewalthandlungen, dass es sich im Kern weder um einen religiösen, noch um einen aus dem Tschad und Sudan in die Zentralafrikanische Republik hereingetragenen Konflikt handelt. Um der Gefahr weiterer zukünftiger Gräueltaten zu begegnen, ist es essenziell, einen umfassenden und alle Akteure einschließenden politischen Diskurs zu erreichen und langfristig die Regierungsprobleme und die chronische Instabilität der Republik zu adressieren. Hierfür kann an der Arbeit des BINUCA angeknüpft werden. Der Plünderung der natürlichen Ressourcen und der weit verbreiteten Korruption muss entgegen gewirkt werden. Dies und eine Implementierung der Regulierungen des Kimberly Prozesses würde den Diamantensektor als potenzielle Einnahmequelle für Milizen und Kriminelle unattraktiver gestalten. Es müsste auch ein Modell gefunden werden, das Minderheiten aus den Randgebieten des Landes am politischen Prozess beteiligt. Stabilität in der Zentralafrikanischen Republik herzustellen und dauerhaft Gräueltaten zu verhindern, wird die geduldige und langwierige Unterstützung der internationalen Gemeinschaft erfordern.